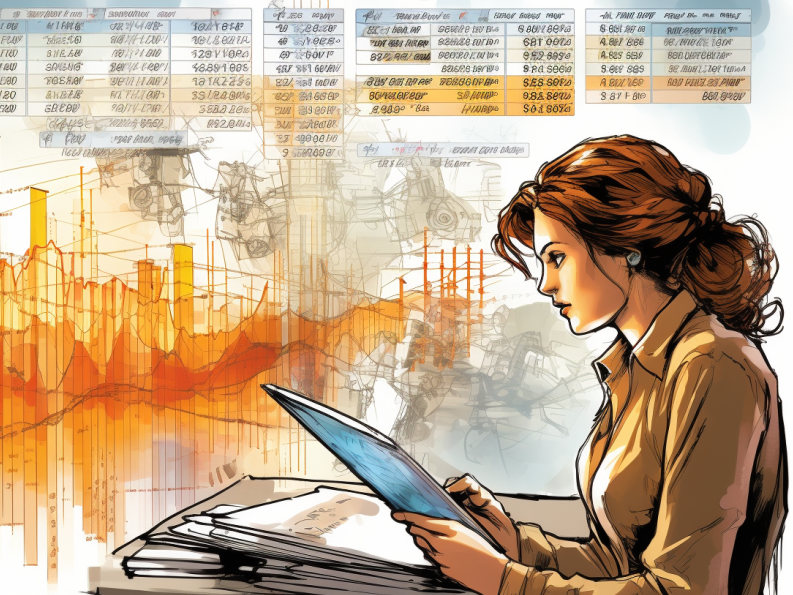Stellen Sie sich vor: Sie führen eine typische Vorlesung durch. Ihr Vorlesungsskript mit einem Diagramm erscheint auf der Leinwand, so statisch, so gut. Aber anstatt es nur zu präsentieren, klicken Sie in die Visualisierung Ihrer Auswertung hinein, ändern eine Variable im Code oder wählen andere Daten. Sofort können Sie zeigen, wie sich die Kurven verändern und vor allem warum sie sich verändern. Und Ihre Studenten können das auch, denn Ihr Skript ist ein Notebook – ein Jupyter Notebook.
Sie erstellen ein Skript zur Einführung in die Programmierung und Ihre Studierenden tippen den Code nicht nur ab, sondern können Ihn direkt in einem interaktiven Textbuch verändern und ausführen, Aufgaben und kleine Programmierprojekte angehen, sind so nicht nur theoretisch mit der Programmierung und einer Datenanalyse beschäftigt, sondern sind auch hier schon mitten drin.
Dies sind nur zwei Anwendungsbeispiele für den Einsatz von Jupyter in der Lehre. Studierende und Lehrende können mit Hilfe von Jupyter Notebooks in einer gemeinsamen, webbasierten Umgebung interaktiv programmieren, Daten analysieren, ganze Texte schreiben, die Ergebnisse direkt in den Notebooks visualisieren und auswerten.
Diese Vielseitigkeit der Open-Source-Software macht Jupyter1 besonders wertvoll für Fächer wie Data Science, Mathematik und Naturwissenschaften. Aber auch in den Wirtschaft-, Sozial- und Geisteswissenschaften wird die Plattform zunehmend genutzt, um komplexe Themen greifbar zu machen.
Seit dem Wintersemester 2023 steht erstmals allen Angehörigen der Universität Bremen eine Jupyter Cloud für die Lehre zur Verfügung. Ein wichtiger Baustein, wenn es um die Etablierung von Themen, wie Data Literacy, Reproducable ScIence und forschenden Studieren geht. In diesem Artikel stellen wir Jupyter und insbesondere den Cloudservice von Jupyter an der Universität Bremen, JupyterHub2, vor, präsentieren Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungsberichte vor Ort.
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| … | … |
Part of the bigger picture
…